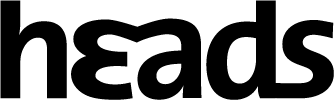Die nicht mehr so nahe Bank
Die Zürcher Kantonalbank bekundet ausgerechnet in ihrem Jubiläumsjahr Mühe, ihr Markenversprechen einzulösen.
Vor 20 Jahren suchte ich als Sponsoringchef des «Tages-Anzeigers» einen potenten Sponsoring-Partner im Kulturbereich und fand ihn bei der ZKB in der Person des damaligen Sponsoringchefs Nikodemus Herger. Gemeinsam suchten wir neue und aufregende Projekte, die einem Bedürfnis der Bevölkerung entsprachen und kulturellen Mehrwert schufen. Zwei davon, das Lunch-Kino und das Jazznojazz-Festival, gibt es heute noch. In der Zusammenarbeit erlebte ich die ZKB und ihre Kommunikationsprofis als sehr nahe bei den Menschen und ihren Bedürfnissen. Die nahe Bank eben.
Aktuell kämpft die ZKB gerade dafür, dass sie der Stadt Gondeln über den See schenken darf. Schenken ist eigentlich übertrieben, denn die 40 bis 60 Millionen Baukosten sollen über Ticketpreise wieder eingespielt werden. Einigen Bürgerinnen und Bürgern gefiel ein solcher «Europapark am See» überhaupt nicht und sie rekurrierten erfolgreich beim Baurekursgericht. Nach der Niederlage zieht die Bank das Urteil nun an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich weiter. Diesen Schritt habe man sich gut überlegt, ist auf der Jubiläumsseite der ZKB zu lesen, denn nach einer Meinungsumfrage stehe «zwei Drittel der Bevölkerung der Idee neutral bis sehr positiv gegenüber». Im Umkehrschluss: Ein Drittel der Bevölkerung findet die Idee eher nicht so gut bis sehr schlecht. Die ZKB gibt sich kämpferisch und CEO Martin Scholl meinte in der NZZ, man realisiere das Projekt, auch wenn man die Bahn wegen der juristischen Auseinandersetzungen statt im Jubiläumsjahr erst einige Jahre später bauen könne. Scholl: «Man kann uns nicht stoppen.» Hat sich die ZKB auch gut überlegt, wie ihr Handeln auf ihre Marke einzahlt? Die Kantonalbank, die nahe Bank, die sich von einem Drittel der Bevölkerung nicht stoppen lässt?
Szenenwechsel und wieder zuerst einen Sprung in die Vergangenheit: Vor einigen Jahren stehe ich in der Confiserie Sprüngli an der Theke, neben mir eine ältere Dame aus Deutschland. Sie fragt die Kassiererin: «Kann ich bei Ihnen mit Euro zahlen oder nehmen Sie nur Fränkli?» Hatte sie gerade Fränkli gesagt? Ich kann mich nicht zurückhalten und kläre die Dame auf: «Bitte entschuldigen Sie, wenn ich mich kurz einmische. Ihnen ist zwar richtigerweise nicht entgangen, dass wir Schweizer so ziemlich alles verkleinern – von Hüüsli, über Semmeli, Töffli bis zu den Luxemburgerli, die vor Ihnen stehen. Wir sind wohl die Weltmeister des Diminutivs. Was wir aber nie, aber wirklich gar nie, nie, niemals kleiner machen, ist unser Schweizer Franken. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das «Fränkli» gibt es bei uns nicht. Ich sage Ihnen dies, damit Sie sich in unserem Land nicht unbeliebt machen.» Die Dame bedankte sich artig für die Eingeborenen-Information. Nun lese ich vor einigen Tagen mit Interesse, dass die Zürcher Kantonalbank eine neue App lanciert hat, die mehr aus der 3. Säule machen soll. Und die App hat sogar einen eigenen Namen erhalten. Halten Sie sich fest – sie heisst «frankly». Das ist, wenn sie mich fragen, offen gesagt, nicht so eine gute Idee.
«Die nahe Bank» ist ein attraktives Kundenversprechen, das die Marke seit Jahren positiv auflädt. Die ZKB würde gut daran tun, wieder einmal genauer zu reflektieren, was Nähe ausmacht. Und dann ihr Markenversprechen nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen – erst recht nicht im Jubiläumsjahr.